Von der Schwierigkeit, umzukehren
“Wenn es nicht geht, dann kehren wir einfach um” – ein Satz, der mir schon etliche Male über die Lippen gekommen ist. Doch egal wie bekloppt es auch wurde – umgedreht sind wir noch nie! Irgendwie war der Optimismus immer größer. Dann sagt man sowas wie “jetzt sind wir schon so weit gekommen”, “umzudrehen würde noch viel länger dauern” oder “gleich wird’s bestimmt besser”. Alles Unfug.
Der Grund für solche Floskeln ist ganz einfach: es ist verdammt schwierig, umzukehren. Zumindest für mich. Denn umzudrehen heißt aufzugeben. Es ist ein Scheitern. Und das fühlt sich nie gut an. Dass es aber auch okay sein kann, nein, sogar vernünftig – darum geht es heute in der Fortsetzung unserer Reise durch das schöne Kolumbien.
Wo waren wir stehengeblieben?
Achja – wir sind jetzt auf zwei Moppeds unterwegs! (Wer es noch nicht mitbekommen hat, kann im letzten Beitrag nachlesen, wie es dazu gekommen ist). Die letzten Monate hatten wir uns darum gekümmert, alles zu organisieren (ohne unsere lieben Freunde und Familie in Deutschland hätte es nicht geklappt!) und nun war es endlich so weit: Wir konnten den zweiten Tiger in Bogotá abholen.
Das war auch eine interessante Erfahrung. Oder sagen wir’s mal so: Wer eine andere Perspektive auf die deutsche Bürokratie bekommen möchte, dem können wir einen Motorradtransport nach Kolumbien empfehlen. Das Prozedere haben wir in einem Video festgehalten:
Back to the jungle!
Nachdem wir den Bürokratie-Wahnsinn hinter uns gebracht hatten, wollte der neue Tiger natürlich ordentlich eingefahren und getestet werden.
Und zwar noch mal quer durch halb Kolumbien, zurück nach Ecuador. Dort war vor zwei Monaten Regenzeit und wir konnten wegen Bergstürzen nicht in den Dschungel fahren. Nun könnten wir die Bootstour in den Amazonas nachholen und gleichzeitig unsere 90-Tage-Visa bei einem Borderrun verlängert bekommen. Es geht also wieder in den Süden.
Ein Abstecher in die Wüste
Die ersten Kilometer auf zwei Motorrädern waren recht aufregend (was nicht zuletzt am bogotanischen Verkehr liegt) – hauptsächlich aber ein wahnsinnig überwältigendes Gefühl, nun endlich auf zwei Bikes unterwegs zu sein!





Das erste Highlight auf unserem Weg gen Süden ist die Tatacoa-Wüste. Heiß, trocken und mega schön. Es ist wieder einer dieser Orte, wo man sich unheimlich freut, mit dem eigenen Motorrad unterwegs zu sein.
Auf den unasphaltierten Pisten übe ich mich zum ersten Mal mit so einem großen Motorrad. Wir fahren auf tollen Strecken und verbringen ein paar einsame Tage in der Wüste.






















Schlangenlinien
Was dann folgt, ist ziemlich hässlich. Auf den rund tausend Kilometern zur ecuadorianischen Grenze verwandelt sich die Straße in eine derartige Löcherpiste, dass wir nur noch damit beschäftigt sind, Schlangenlinien zu fahren. Manche Löcher sind so tief, man könnte ungelogen ein Bad darin nehmen. Wenigstens herrscht wegen dieses Zustands wenig Verkehr und das unaufhörliche Überholspiel im Rest Kolumbiens wird uns weitestgehend erspart.
Schön ist jedoch, dass sich weniger Touristen hierher verirren. Wir genießen Exotenstatus, der Gelegenheit bietet, Menschen etwas kennenzulernen. So halten wir ein Schwätzchen mit der Kaffeeverkäuferin am Straßenrand, die sich sichtlich darüber wundert, wie man so lange auf dem Motorrad unterwegs sein kann (ob das nicht schrecklich langweilig wäre?). In einem Hostal lernen wir Ricardo kennen, der uns sofort anbietet, ihn Zuhause in Bucaramanga besuchen zu kommen. Eine liebe Herbergsmutter schenkt uns bei der Weiterfahrt das lokale Gebäck als Proviant. Und eine Gruppe junger Männer geben ihr gebrochenes Englisch zum Besten, um mir Komplimente zu machen.
Brennende Straßen
Nach ein paar Umwegen kommen wir schließlich im äußersten Süden Kolumbiens an, nur noch ein paar Kilometer von der Grenze entfernt.
Die vergangenen Tage gab es immer mal wieder beunruhigende Nachrichten von Ecuador, welche leider immer schlechter geworden sind. Nachdem die Regierung vor einigen Tagen im Rahmen von Auflagen der Gewährung eines Kredits des IWF die Subventionierung der Treibstoffpreise gestrichen hatte, gab es einen Streik im Transportsektor.
Inzwischen hat sich die indigene Bevölkerung den Protesten angeschlossen und die Straßen sind landesweit gesperrt. Baumstämme, brennende Reifen, Nägel auf den Straßen sowie fehlendes Benzin bringen derzeit den Verkehr zum Stillstand. Nahrungsmittel werden knapp. Es gab Plünderungen. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen.
Wir sind hin- und hergerissen: Einerseits wollen wir uns nicht von – nach unserer Erfahrung häufig übertriebenen und nicht differenzierenden – Reisewarnungen abschrecken lassen. Die meisten Sperrungen befinden sich in den Großstädten und auf umliegenden Hauptstraßen, wo wir vorerst nicht unterwegs wären.
Andererseits bekommen wir durch Freunde und Bekannte jedoch direkt mit, wie schwierig es ist, sich überhaupt fortzubewegen. Zudem sprechen sich lokale Motorradclubs sehr deutlich dagegen aus, momentan einzureisen. Wo wir uns auch erkundigen: überall wird gewarnt. Wie lange alles andauern wird und wie sich die Lage entwickelt – das kann keiner sagen.
Auch wenn es schwer fällt, entscheiden wir uns im letzten Moment gegen die Einreise. Das Risiko ist anscheinend zu hoch und wir müssen nicht die Helden sein. Wir wären lediglich leichte Opfer.
Unruhige Zeiten
Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: In den kommenden Wochen wird in Südamerika noch viel mehr passieren. In Chile, Bolivien, Argentinien und auch hier in Kolumbien werden Menschen auf die Straßen gehen, um gegen ihre Regierung zu protestieren. Worum es dabei in den verschiedenen Ländern geht, kann man zum Beispiel hier oder hier nachlesen.
Uns wird (wieder mal) bewusst, wie viel Glück wir auf der bisherigen Reise hatten. Stets konnten wir uns unbeschwert durch Südamerika bewegen. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell sich die Stimmung ändern kann.
…dann bin ich eben die Spaßbremse
Nun sahen wir die Ereignisse als Chance, die berühmte “Todesstraße” Kolumbiens, das Trampolina de la Muerte zu fahren. Sie ist die südlichste Verbindung der beiden Hauptstraßen, die von Nord nach Süd führen. Woher sie diesen Namen hat, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken: es ist nicht die sicherste Straße. Entlang tiefer Abgründe geht es auf einer engen Erdstraße über den Bergpass. Dabei gibt es einige Wasserdurchquerungen und – das Schlimmste – einen mörderischen Verkehr.
Wenn man die Straße vorsichtig und im Trockenen fährt, dann ist es wohl gut machbar. Das Problem ist nur, dass es in dieser Region eigentlich immer regnet. Wir wollen es versuchen und warten auf besseres Wetter.










Fünf Tage später stehen wir außergewöhnlich früh auf, um aufzubrechen – und nach nur zehn Minuten im strömenden Regen zu stehen (obwohl Sonne angesagt war). Was für ein Reinfall!
Frustriert halten wir am Straßenrand und besprechen die Lage.
Da alle anderen Verbindungsstraßen für noch schlimmere Verhältnisse bekannt sind, würde ein Umdrehen bedeuten, dass wir die rund tausend Kilometer, die wir gekommen sind, wieder zurückfahren müssten. Darauf haben wir überhaupt keine Lust.
Andererseits ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Regen in den nächsten Stunden nachlassen oder gar aufhören wird. Obwohl Moe und ich vorher beschlossen hatten, dass wir diese Straße keinesfalls im Regen fahren, will Moe es jetzt doch versuchen. Zu enttäuschend klingt die Alternative.
Ich führe hingegen einen inneren Kampf. Fühle mich nicht bereit für steile Schlammpisten und tiefe Wasserdurchquerungen, die uns auf dem Trampolina bevorstehen. Habe aber auch das Gefühl des Versagers, einen Rückzieher zu machen, wenn Moe es doch wagen will.
“Wir können es uns ja mal anschauen”, beschließe ich. Dann geht der Kampf los. Die Straße verwandelt sich binnen Minuten in einen kleinen Fluss und ich frage mich zunehmend, was das hier eigentlich soll. Ein paar Mal schlage ich vor, besser umzukehren. Moe bleibt jedoch hoffnungslos optimistisch. “Für mich ist das in Ordnung. Du entscheidest”, entgegnet er mir immer und immer wieder, woraufhin ich natürlich weiterfahre.
Denn ich will nicht diejenige sein, an der es scheitert. Dass wir gerade schon an der Grenze umkehren mussten, macht alles natürlich noch schwieriger. “Ich dachte, wir hätten vorher beschlossen, dass wir es vom Wetter abhängig machen. Und das Wetter könnte nicht eindeutiger dagegen sprechen.”
Dicker Nebel verwehrt uns jegliche Sicht, der Himmel hängt in einem tiefen Grau und der strömende Regen kennt keine Gnade. Moe bleibt jedoch bei seiner Aussage, dass er mir die Entscheidung überlässt. “Wir wollten diese Straße wegen ihrer berühmten Aussicht fahren, von der wir unter diesen Umständen überhaupt nichts sehen können. Wofür sollen wir diesen Kampf austragen?”
Nur allzu gut erinnere ich mich an die zahlreichen Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Wie oft sind wir schon im Schlamassel gelandet, obwohl ich mir jedes Mal geschworen hab, nächstes Mal vernünftiger zu sein? Immer wieder habe ich mich von Moe breitschlagen lassen. Weil mir die Rolle der Spaßbremse überhaupt nicht zusagt.
Ich bin hin- und hergerissen, vor allem aber sauer darüber, dass Moe mich in eine äußerst unangenehme Rolle drängt (ohne, dass er dies natürlich beabsichtigt oder meinen Punkt versteht). Doch ein Spiel ist das hier nicht. Womöglich erspare ich uns viele Nerven. Schließlich siegt die Erfahrung und die Vernunft: “Lass uns umdrehen.” Drei schwere Worte.
Wir kehren um und fahren zurück nach Mocoa. Im Ort angekommen flüchten wir in die erstbeste Bäckerei, um dem strömenden Regen auszusitzen. Keiner sagt was, wir starren nur raus auf’s Wasser, das unaufhörlich vom Himmel herunterprassel. Betrübte Stimmung.
Geduldsprobe
Es geht also alles wieder alles zurück, bis wir in die Kaffeezone Kolumbiens gelangen.








Hier haben wir nun die Aufgabe, das Visum bei einer der Migraciones zu verlängern. Es stellt sich heraus, dass man diesen Prozess komplett online abwickeln kann. “Wie fortschrittlich”, denken wir und registrieren uns gleich. Innerhalb einer halben Stunde ist alles hochgeladen und wir sollen in den nächsten 24 Stunden eine Antwort bekommen. Das klingt ja fast zu einfach, um wahr zu sein.
Ist es dann auch. Wir hören tagelang nichts mehr von der Migracion. Als wir schließlich bei der Dienststelle auflaufen, füllt der Mann am Schalter ein weiteres Mal das gleiche Onlineformular für uns aus – na, das hätten wir uns auch sparen können. Als ich meine Besorgnis kundtue, verspricht er, dass wir auf jeden Fall morgen eine Antwort haben werden. Dies bleibt ein leeres Versprechen.
So stehen wir einen Tag vor dem Ablauf unserer Visa wieder vorm Büro, nun sichtlich nervös. Als die Tür geöffnet wird, nimmt uns derselbe Mann direkt die Pässe aus der Hand, ohne eine Miene zu verziehen. Wir sind verwirrt, warten aber brav. Eine dreiviertel Stunde später haben wir sie dann endlich: Die Verlängerung. Die Reise kann weitergehen!






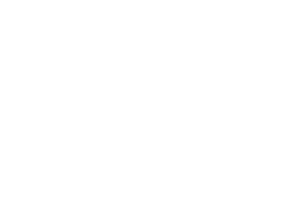
Umzukehren zeigt manchmal mehr Stärke, als weiterzufahren! Ich kann deine Gefühle absolut nach vollziehen und beglückwünsche dich zu deiner starken Entscheidung Nicki. Liebe Grüße aus Kambodscha
Umdrehen ist oft schwerer als weitermachen. Ich kenne das vom Klettern (Alpin). Aber ganz unterm Strich ist das die bessere Entscheidung!
Alleine Dein Satz “Wir fahren hier wegen der Aussicht lang, aber es gibt keine Aussicht. Warum fahren ist dann trotzdem?” sagt doch alles.
Gute Entscheidung. Nein sagen macht stärker!
🙂
Viel Glück weiter Euch beiden
Michael
Umdrehen ist echt schwer.
Hatte selbst das Problem in Rumänien auf einer Schotterpiste. Die Vorfreude ist gross, man hat Texte gelesen, Fotos und Videos gesehen und dann steht man am Anfang der Route.
Doch dann muss man sich irgendwann eingesehen heute ist nicht der Tag an dem ich das erleben werde…
Übrigens, herrliches Video zum neuen Motorrad.
Servus es zwoa,
es sind wirklich verzwickten Momente.
Das Umdrehen ist wirklich nicht einfach. Ich sage mir dann immer: ” Man braucht ja einen Grund um wieder zu kommen” 😉
Das nächste mal habt ihr schönes Wetter für die Todesstraße.
Gruss,
Tom
Das sage ich auch immer XD
Mit der Zeit wird man da gelassener 🙂
Liebe Grüße